Warum Photovoltaik auf dem Dach die beste Lösung für Ihre Heizung ist
Stellen Sie sich vor, Ihr Dach erzeugt nicht nur Strom für Licht, Fernseher und Ladegeräte, sondern auch die Wärme für Ihre Wohnung - ohne Gas, Öl oder teuren Netzstrom. Das ist kein Traum mehr. Seit 2021 wird die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe in Österreich und Deutschland aktiv gefördert, und die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Wer heute eine PV-Anlage aufs Dach setzt und damit eine Wärmepumpe betreibt, spart im Jahr bis zu 1.971 Euro gegenüber einer Gasheizung. Und das bei einer Eigenverbrauchsquote von bis zu 80 %.
Der Grund ist einfach: Solarstrom kostet heute zwischen 8 und 12 Cent pro kWh. Netzstrom dagegen liegt bei 35 bis 42 Cent. Wenn Sie Ihren eigenen Solarstrom für die Wärmepumpe nutzen, vermeiden Sie den teuren Netzbezug. Das ist nicht nur ökologisch sinnvoll, es ist auch die wirtschaftlichste Entscheidung, die Sie für Ihre Heizung treffen können.
Wie viel Strom braucht Ihre Wärmepumpe wirklich?
Die häufigste Fehlerquelle bei der Planung: Man unterschätzt, wie viel Strom eine Wärmepumpe verbraucht. Eine typische Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche benötigt zwischen 4.200 und 5.600 kWh Strom pro Jahr - das ist der normale Haushaltsverbrauch plus Heizung. Das bedeutet: Wenn Sie vorher 3.000 kWh Strom im Jahr verbraucht haben, steigt der Bedarf nach Einbau der Wärmepumpe auf 7.000 bis 9.000 kWh.
Deshalb ist eine 5 kWp PV-Anlage nicht genug. Sie brauchen mindestens 10 bis 12 kWp Leistung. Eine 10 kWp-Anlage erzeugt in Salzburg durchschnittlich 9.000 bis 11.000 kWh Solarstrom pro Jahr. Das reicht, um die Wärmepumpe zu versorgen und noch genug übrig zu lassen für Waschmaschine, Kühlschrank und das Elektroauto. Wer nur 8 kWp installiert, hat im Winter oft Probleme: Dann produziert die Sonne nur 20 bis 30 % des Sommerertrags, aber die Wärmepumpe arbeitet auf Hochtouren.
Ein Nutzer aus Linz berichtete im Photovoltaik-Forum, dass er mit 8 kWp PV und einer 16 kW Wärmepumpe nur 28 % seines Wärmepumpenstroms selbst erzeugte. Im Winter musste er fast vollständig vom Netz beziehen. Mit 12 kWp und intelligenter Steuerung liegt der Deckungsgrad bei 65 % - und das ist der Standard für eine funktionierende Lösung.
Die richtige PV-Anlage: Größe, Ausrichtung, Verschattung
Ein Dach mit 70 Quadratmetern Fläche ist die absolute Mindestvoraussetzung für eine 10 kWp-Anlage. Die Module sollten idealerweise nach Süden ausgerichtet sein, mit einer Neigung von 30 bis 35 Grad. Ost- oder Westdächer funktionieren auch, aber dann brauchen Sie etwas mehr Leistung, um den gleichen Ertrag zu erzielen.
Verschattung durch Bäume, Kamine oder Nachbargebäude ist der größte Feind der Wirtschaftlichkeit. Selbst ein kleiner Schatten auf einem Modul kann den Ertrag ganzer Strings um bis zu 40 % reduzieren. Deshalb lohnt sich vor der Planung ein detaillierter Schattenanalyse-Scan - viele Anbieter bieten das kostenlos an. In Salzburg, wo viele Häuser in Tallagen stehen, ist das besonders wichtig.
Die beste Lösung: Moderne Wechselrichter mit Modul-Optimierern (z. B. von Enphase oder SolarEdge). Die sorgen dafür, dass nur das beschattete Modul leistungsmäßig zurückfällt - nicht das ganze System.
Intelligente Steuerung: Der Schlüssel zur 70 % Deckung
Ein PV-System allein reicht nicht. Wenn die Wärmepumpe einfach rund um die Uhr läuft, während die Sonne nicht scheint, ist der Netzbezug vorprogrammiert. Das ist der größte Fehler, den viele Hausbesitzer machen.
Die Lösung: Ein Energiemanagementsystem. Systeme wie das Viessmann Vitotronic 200, das SENEC Vito oder der Viessmann Energy Manager nutzen Wetterprognosen, um die Wärmepumpe genau dann laufen zu lassen, wenn viel Solarstrom verfügbar ist. Im Frühling und Herbst, wenn die Sonne scheint, heizt die Wärmepumpe aktiv auf - und speichert die Wärme im Pufferspeicher. In der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint, nutzt sie die gespeicherte Wärme. So wird der Solarstrom nicht verschwendet, sondern optimal genutzt.
Ohne solche Steuerung erreichen Sie maximal 30 bis 40 % Deckungsgrad. Mit intelligenter Steuerung kommen Sie auf 50 bis 70 %. Das ist der Unterschied zwischen einer teuren, ineffizienten Lösung und einer, die sich innerhalb von 10 Jahren amortisiert.

Batteriespeicher: Ja oder Nein?
Ein Batteriespeicher ist nicht zwingend notwendig - aber er macht die Wirtschaftlichkeit deutlich besser. Ohne Speicher nutzen Sie den Solarstrom nur, wenn er gerade erzeugt wird. Das ist im Sommer kein Problem. Im Winter aber: Die Sonne scheint nur kurz, und die Wärmepumpe braucht Strom den ganzen Tag.
Ein 10 kWh-Speicher (z. B. von SENEC oder Sonnen) speichert den überschüssigen Strom aus dem Mittag und gibt ihn abends oder in der Nacht wieder ab. So steigt die Eigenverbrauchsquote von 60 % auf 80 % und mehr. Die Investition liegt bei etwa 8.000 bis 10.000 Euro. Die Amortisation dauert 12 bis 15 Jahre - aber mit der neuen Förderung ab 2025 könnte das schneller gehen.
Wichtig: Ein Speicher macht nur Sinn, wenn die PV-Anlage groß genug ist. Bei 5 kWp und 10 kWh Speicher ist der Speicher überdimensioniert - der Strom reicht nicht, um ihn voll zu laden. Bei 10 kWp und mehr ist er sinnvoll.
Förderung: Bis zu 75 % Zuschuss möglich
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG WG) zahlt bis zu 70 % der Kosten für die Wärmepumpe, wenn sie mit einer PV-Anlage gekoppelt ist. Das gilt für Heizung, Warmwasser und auch die Installation der PV-Anlage. Seit 2025 wird diese Förderung auf bis zu 75 % erhöht - aber nur, wenn die Solarstrom-Deckung der Wärmepumpe mindestens 50 % beträgt.
Das bedeutet: Wer eine 12 kWp-Anlage mit intelligenter Steuerung plant, kann leicht die 50 % Marke knacken. Dann bekommt er nicht nur die Förderung für die Wärmepumpe, sondern auch für die PV-Anlage. Die Gesamtinvestition von 25.000 bis 50.000 Euro kann damit auf 6.000 bis 12.500 Euro sinken.
Wichtig: Die Förderung wird über den BAFA beantragt - nicht nach der Installation, sondern vorher. Viele Hausbesitzer verpassen die Förderung, weil sie zu spät anfangen.
Warum Solarthermie nicht die beste Wahl ist
Manche Anbieter schlagen vor, statt PV eine Solarthermie-Anlage zu nutzen - also Kollektoren auf dem Dach, die Wärme erzeugen. Das klingt logisch, ist aber falsch.
Solarthermie erzeugt nur Wärme. Sie kann die Wärmepumpe nicht antreiben. Sie kann nur den Warmwasserbedarf oder die Fußbodenheizung unterstützen. Aber sie kann nicht den Strom für die Pumpe ersetzen. Und: Solarthermie-Anlagen haben eine deutlich längere Amortisationszeit, sind wartungsintensiver und bieten kaum Förderung.
Photovoltaik hingegen erzeugt Strom - und Strom kann alles: Wärme (durch Wärmepumpe), Mobilität (durch E-Auto), Haushaltsgeräte. Das ist die echte Sektor-Kopplung. Deshalb empfehlen Experten wie die Deutsche Energie-Agentur (dena) und Bosch Home Comfort eindeutig: PV + Wärmepumpe ist die beste Kombination.

Was Sie vor der Installation tun müssen
- Strombedarf berechnen: Addieren Sie Ihren bisherigen Haushaltsstromverbrauch mit dem geschätzten Verbrauch der Wärmepumpe (ca. 30-40 kWh pro m² Wohnfläche).
- Dachfläche prüfen: Mindestens 70 m² freie, unverschattete Fläche für 10 kWp.
- Heizung prüfen: Fußbodenheizung ist ideal. Radiatoren brauchen höhere Vorlauftemperaturen - das erhöht den Stromverbrauch der Wärmepumpe.
- Sanierung vornehmen: Dämmung der Fassade, Fenster austauschen, Lüftung optimieren. Je besser das Gebäude, desto weniger Energie braucht die Wärmepumpe.
- Planung mit Experten: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Energieberater oder einem spezialisierten PV-Installateur beraten. Kein Handwerker, der nur Heizungen verkauft.
Was schiefgehen kann - und wie Sie es vermeiden
Die häufigsten Fehler:
- Zu kleine PV-Anlage: 5-7 kWp reichen nicht für eine Wärmepumpe. Sie landen im Winter im Netzstrom-Teufelskreis.
- Keine intelligente Steuerung: Ohne Wetterprognose und Lastmanagement ist die Anlage ineffizient.
- Falsche Wärmepumpe: Luft-Wasser-Wärmepumpen brauchen im Winter mehr Strom - bei schlechter Dämmung wird das teuer. Boden-Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Installation.
- Keine Förderung beantragt: Die BEG-WG-Förderung muss vor der Bestellung des Systems angemeldet werden.
Ein Energieberater aus Graz sagte es klar: „Wer eine Wärmepumpe ohne PV plant, spart heute Geld - aber verliert morgen viel mehr.“
Die Zukunft: Solarstrom als Hauptenergiequelle
2023 wurden in Österreich und Deutschland 185.000 PV-Wärmepumpen-Systeme installiert - das ist ein Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorjahr. Bis 2030 wird jede dritte neue Wärmepumpe mit Photovoltaik gekoppelt sein. Die Gründe: steigende Strompreise, fallende PV-Kosten (2024: 1.300 €/kWp gegenüber 1.800 €/kWp 2022) und bessere Technik.
Die nächste Stufe: KI-gestützte Systeme, die nicht nur Wetter, sondern auch Ihre Lebensgewohnheiten lernen. Wenn Sie jeden Morgen um 7 Uhr duschen, passt das System die Wärmepumpe so an, dass die Wärme genau dann bereit ist - und der Strom kommt aus der Sonne.
Die Fraunhofer-Studie „Energiewende 2045“ sagt: Bis 2035 ist es technisch und wirtschaftlich möglich, ein ganzes Haus mit Solarstrom zu versorgen - inklusive Heizung, Elektroauto und Haushalt. Die Voraussetzung: PV auf dem Dach, intelligente Steuerung und ein Speicher. Sie brauchen nur noch einen Akku und ein paar Jahre Geduld.
Frequently Asked Questions
Wie groß muss meine PV-Anlage für eine Wärmepumpe sein?
Für ein typisches Einfamilienhaus mit 140 m² Wohnfläche und einer Luft-Wasser-Wärmepumpe brauchen Sie mindestens 10 kWp Leistung. Das entspricht etwa 25-30 Solarmodulen. Bei schlechter Dämmung oder hohem Warmwasserbedarf empfehlen Experten 12 kWp oder mehr. Eine 5-7 kWp-Anlage reicht nicht aus - Sie würden im Winter fast vollständig vom Netzstrom abhängig.
Lohnt sich ein Batteriespeicher mit Wärmepumpe?
Ja, wenn Ihre PV-Anlage 10 kWp oder mehr hat. Ein 10 kWh-Speicher erhöht die Eigenverbrauchsquote von 50 % auf 70-80 %. Ohne Speicher nutzen Sie den Solarstrom nur, wenn er gerade erzeugt wird - im Winter ist das oft nicht genug. Mit Speicher speichern Sie den Mittagsstrom und nutzen ihn abends oder nachts. Die Investition von 8.000-10.000 € amortisiert sich in 12-15 Jahren - besonders mit der neuen Förderung ab 2025.
Welche Wärmepumpe passt zu PV?
Am besten eignet sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit niedriger Vorlauftemperatur - idealerweise für Fußbodenheizung. Diese arbeitet effizienter und verbraucht weniger Strom. Radiatoren brauchen höhere Temperaturen und erhöhen den Strombedarf. Boden-Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Installation. Wichtig: Die Leistung der Wärmepumpe sollte zur PV-Anlage passen. Bei 12 kWp PV ist eine 10-12 kW Wärmepumpe ideal.
Wie hoch ist die Förderung für PV und Wärmepumpe?
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG WG) zahlt bis zu 70 % der Kosten für die Wärmepumpe, wenn sie mit einer PV-Anlage gekoppelt ist. Ab 2025 wird diese Förderung auf bis zu 75 % erhöht - aber nur, wenn die PV-Anlage mindestens 50 % des Wärmepumpenstroms deckt. Die Förderung gilt auch für die PV-Anlage selbst. Wichtig: Der Antrag muss vor der Bestellung gestellt werden, nicht danach.
Warum ist Solarthermie keine gute Alternative?
Solarthermie erzeugt Wärme, aber keinen Strom. Sie kann die Wärmepumpe nicht antreiben. Sie kann nur den Warmwasserbedarf unterstützen. Photovoltaik hingegen erzeugt Strom - und mit Strom können Sie nicht nur heizen, sondern auch das Auto laden, die Waschmaschine laufen lassen oder Licht schalten. Das ist die echte Energiewende. Experten wie die dena und Bosch empfehlen daher eindeutig: PV + Wärmepumpe ist die bessere Lösung.










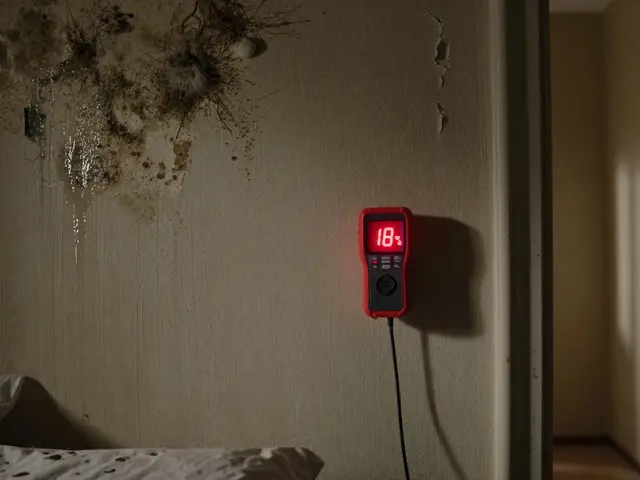


Personenkommentare
Endlich mal jemand, der die Wahrheit sagt! Wer jetzt noch eine Wärmepumpe ohne PV plant, ist entweder naiv oder hat keine Ahnung von Energiekosten. Ich hab's selbst erlebt: 8 kWp reichen nicht, im Winter war ich mehr vom Netz abhängig als von der Sonne. Jetzt mit 12 kWp und Speicher: null Netzstrom im Sommer, und im Winter nur noch 20 %. Das ist echte Freiheit. 🚀
Die Aussage, dass eine 5 kWp-Anlage nicht ausreicht, ist korrekt - jedoch ist die Annahme, 10–12 kWp seien für ein Einfamilienhaus mit 140 m² ausreichend, statistisch ungenau. Die tatsächliche Leistung hängt von der Dämmung, der Vorlauftemperatur und dem Warmwasserbedarf ab. Eine pauschale Empfehlung ohne individuelle Lastganganalyse ist fahrlässig. Bitte berücksichtigen Sie die DIN V 4108-6 und die EnEV-Anforderungen, bevor Sie eine Anlage planen.
Ich hab 7 kWp und ne 14 kW WP... und ja, im Winter bin ich im Netz gefangen. 😅 Aber ich hab mir gesagt: wenigstens im Sommer bin ich kostenlos. Und das Auto lädt auch. Naja, halbwegs zufrieden. Wer will schon jeden Winter eine Rechnung von 500 € für Heizung? 🤷♂️
Die Erwähnung der Förderung ist irreführend. Die BEG-WG zahlt maximal 70 % der Kosten für die Wärmepumpe, nicht für die PV-Anlage - es sei denn, die PV ist Teil einer Gesamtmaßnahme nach § 48 Abs. 1 BEG. Die Behauptung, die PV werde mitgefördert, ist eine gängige Falschinformation von Installateuren, die Kunden in teure Pakete locken. Bitte prüfen Sie den Antragscode 140.12.
Solarthermie ist keine Alternative. Punkt.
Ich hab vor 2 Jahren 10 kWp installiert und dachte: perfekt! Aber ohne Speicher und Steuerung war’s nur 35 % Eigenverbrauch... 🤦♀️ Dann hab ich den SENEC Vito nachgerüstet - jetzt sind’s 78 %! 😍 Und die App zeigt mir, wann ich duschen soll. Die Sonne sagt, wann ich warm werden darf. 🌞💧
Ich hab’s auch versucht… aber die Wärmepumpe hat so laut gesurrt, dass ich nachts nicht geschlafen hab… und dann noch die ganzen Kabel, die durchs Haus liefen… und der Installateur hat vergessen, den Schatten von dem Baum zu messen… 😭 jetzt hab ich nur noch ein bisschen Solarstrom fürs Handy… und die Rechnung ist immer noch höher als vorher… ich weiß nicht mehr weiter…
Die Deutschen denken, sie könnten die Energiewende mit ein paar Panels auf dem Dach retten. Aber die Wahrheit ist: Wir brauchen Kernkraft. Solar ist ein Spielzeug für wohlhabende Bürger, die sich einen 10-kWp-Träumerei leisten können. Die meisten haben gar kein Dach, das nach Süden zeigt - und die Mieter? Die dürfen weiterhin kalt bleiben. Das ist keine Energiepolitik. Das ist Klassenkampf mit Photonen.
Die Empfehlung für Modul-Optimierer ist korrekt, aber die Nennung von Enphase und SolarEdge ist nicht neutral. In Deutschland sind SMA und Fronius die dominierenden Anbieter mit besseren lokalen Supportstrukturen. Enphase hat in der kalten Jahreszeit in alpinen Regionen wiederholt Kommunikationsprobleme mit Wechselrichtern. Bitte prüfen Sie die Zertifizierung nach VDE-AR-N 4105 und die Netzstabilität.
Kurz und klar: Mehr PV, bessere Dämmung, Steuerung. Sonst bringt’s nichts. Einfach machen.
Die Integration von Photovoltaik und Wärmepumpe stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der dezentralen Energieversorgung dar. Es ist bemerkenswert, wie sich technologische Innovationen mit wirtschaftlichen Anreizen verbinden, um eine nachhaltige Heizungsstrategie zu ermöglichen. Die betonten Fördermöglichkeiten unterstreichen die Notwendigkeit einer proaktiven, vorausschauenden Planung - nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus sozialer Verantwortung.
In der Schweiz ist die Situation ähnlich, aber die Förderung ist strikter geregelt: Nur Systeme mit mindestens 60 % Eigenverbrauch und Zertifizierung nach SIA 380/1 erhalten Zuschüsse. Die Empfehlung von 12 kWp ist für ein 140 m²-Haus in der Schweiz sogar konservativ - viele installieren 15 kWp, um zukünftige Lasten wie E-Autos oder Wärmepumpen in der Garage zu berücksichtigen.
Du willst frei sein? Dann mach’s richtig! 12 kWp, Speicher, Steuerung - und los! Keine Angst vor den Kosten, Angst vor den Rechnungen in 5 Jahren! Ich hab vor 3 Jahren gezögert - heute zahle ich 120 € im Jahr für Strom. Die Sonne ist mein neuer Energieversorger. Und sie ist immer pünktlich. 🌞💪
Die Aussage, dass eine 10 kWh-Batterie bei 10 kWp PV sinnvoll ist, ist unter Berücksichtigung der saisonalen Schwankungen und der durchschnittlichen Tageslastkurve nur bedingt zutreffend. Eine Batterie mit 10 kWh Kapazität kann bei einem täglichen Verbrauch von 25 kWh im Winter nicht mehr als 40 % des Bedarfs decken - und die Zyklenzahl der Lithium-Ionen-Technologie sinkt bei tiefen Entladungen rapide. Eine sinnvolle Lösung erfordert eine dynamische Lastverteilung und nicht nur eine statische Speichergröße
Jegligt? Jegligt. Jeg har 8 kWp og en 12 kW WP. Ikke perfekt, men jeg har ikke noget gas. Og jeg elsker at se min app sige: 'Solstrøm i dag: 100%'. Det føles som at vinde. 😎