Wenn du ein Haus bauen oder umbauen willst, aber der Bebauungsplan dir im Weg steht, bist du nicht allein. Viele Bauherren stoßen auf Situationen, in denen die festgelegten Regeln - etwa zur Gebäudehöhe, Abstand zum Nachbarn oder der zulässigen Nutzungsart - einfach nicht mehr passen. Das kann an einem engen Grundstück liegen, an einer historischen Bausubstanz oder an einem plötzlichen Bedarf, wie der Unterbringung von Flüchtlingen. In solchen Fällen gibt es einen rechtlichen Ausweg: Abweichungen und Befreiungen vom Bebauungsplan. Aber wie funktioniert das wirklich? Und was musst du tun, damit dein Antrag nicht abgelehnt wird?
Was ist der Unterschied zwischen Abweichung, Befreiung und Ausnahme?
Viele verwechseln die Begriffe, aber sie sind rechtlich klar getrennt. Das ist entscheidend, denn je nachdem, welcher Fall vorliegt, musst du andere Gesetze zitieren und andere Unterlagen einreichen.
- Ausnahme: Das ist die einfachste Variante. Sie steht bereits im Bebauungsplan. Wenn der Plan etwa sagt: „Bei genehmigtem Anbau ist eine Abweichung von 0,5 m zur Grundstücksgrenze zulässig“, dann kannst du das einfach nutzen. Du brauchst keinen extra Antrag - du musst nur nachweisen, dass deine Baupläne genau in diese vorhergesehene Ausnahme passen.
- Befreiung: Das ist das, was die meisten meinen, wenn sie von „Ausnahmen“ sprechen. Hier geht es um eine Einzelfallprüfung nach §31 Abs. 2 BauGB. Du musst zeigen, dass deine Baumaßnahme trotz Abweichung von den Festsetzungen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt. Das ist kein Recht - es ist ein Ermessen der Behörde. Und das bedeutet: Auch wenn du alle Voraussetzungen erfüllst, kann die Stadt den Antrag trotzdem ablehnen.
- Abweichung: Dieser Begriff bezieht sich auf die Landesbauordnung, nicht auf den Bebauungsplan. Wenn du zum Beispiel eine Abstandsfläche nicht einhalten kannst, weil dein Grundstück zu klein ist, dann beantragst du eine Abweichung nach §66 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) oder der entsprechenden Landesbauordnung. Hier geht es um bautechnische Vorschriften, nicht um die städtebauliche Planung.
Ein Beispiel: Du willst in einem Wohngebiet ein Dachgeschoss ausbauen, aber der Bebauungsplan schreibt eine maximale Gebäudehöhe von 8 Metern vor. Dein Haus ist jetzt 7,6 Meter hoch - du willst also nur 40 cm mehr. Das ist eine Befreiung vom Bebauungsplan. Wenn du aber den Abstand zum Nachbarn um 30 cm verringern willst, weil die Wand sonst nicht mehr tragfähig wäre, dann brauchst du eine Abweichung von der Bauordnung.
Wann bekommst du eine Befreiung?
Die Gesetze sagen klar: Eine Befreiung ist nur zulässig, wenn drei Bedingungen erfüllt sind - und du musst alle drei nachweisen.
- Gründe des Wohls der Allgemeinheit: Das ist der wichtigste Punkt. Dazu zählen zum Beispiel der dringende Bedarf an Wohnraum, besonders für Flüchtlinge oder sozial Schwache. Auch die Sanierung von Altgebäuden in Innenstädten, die sonst verfallen würden, kann hierher gehören. Die Stadt Greifswald hat in den letzten Jahren viele Befreiungen für Flüchtlingsunterkünfte erteilt - weil der öffentliche Bedarf eindeutig war.
- Städtebauliche Vertretbarkeit: Dein Bauvorhaben darf das Bild des Viertels nicht zerstören. Wenn du in einer Reihenhaussiedlung ein sechsgeschossiges Gebäude bauen willst, ist das nicht vertretbar - selbst wenn du die Nachbarn überzeugst. Aber wenn du in einem historischen Viertel ein altes Haus sanierst und dabei leicht über die Höhenbegrenzung gehst, um die Dachform zu erhalten, dann ist das oft akzeptabel.
- Unbeabsichtigte Härte: Das ist der häufigste Grund für erfolgreiche Anträge. Du musst zeigen: Wenn ich die Vorschrift strikt einhalte, dann wird mein Projekt wirtschaftlich unmöglich oder physisch nicht realisierbar. Beispiel: Ein Haus aus den 1950er-Jahren hat nur 1,20 Meter Abstand zum Nachbarn. Du willst die Fassade sanieren, aber die Bauordnung schreibt 1,50 Meter vor. Wenn du die Wand jetzt um 30 cm zurückziehst, bricht die Dachkonstruktion zusammen. Dann ist das eine unbeabsichtigte Härte - und du hast eine gute Chance auf Befreiung.
Ein besonderer Fall ist §31 Abs. 3 BauGB: Seit 2021 können Gemeinden Befreiungen für den Wohnungsbau erteilen, wenn sie den dringenden Bedarf an Wohnraum anerkennen. Das ist ein wichtiger Neuerung - viele Städte nutzen das jetzt gezielt, um mehr Wohnungen zu bauen. Aber: Auch hier gilt - keine Garantie. Die Behörde entscheidet nach Ermessen.
Was brauchst du für den Antrag?
Ein Antrag ist kein Formular, das du schnell ausfüllst. Es ist ein juristisches Dokument, das deine Argumentation klar, präzise und beweisbar darlegt. Die Behörde prüft nicht nur deine Pläne - sie prüft deine Logik.
- Schriftlicher Antrag: Formulare gibt es in den meisten Städten online - zum Beispiel das BAB 10 in Hessen. Aber der Text darin ist nur der Rahmen. Der entscheidende Teil ist die Begründung.
- Begründung nach §31 BauGB oder §66 NBauO: Hier musst du konkret auf die drei Kriterien eingehen. Nicht: „Ich brauche mehr Platz.“ Sondern: „Die Einhaltung der 1,50-Meter-Abstandsregel führt zu einer unzumutbaren Verkleinerung der Wohnfläche von 120 auf 85 Quadratmeter. Die Sanierung wäre wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Grundzüge der Planung - ruhige Wohnnutzung - bleiben erhalten.“
- Bauvorlagen: Das sind nicht nur Grundrisse. Du brauchst: Lageplan, Grundriss, Schnitte, Ansichten, Fotos der bestehenden Nachbargebäude, eine formlose Bau- und Nutzungsbeschreibung mit Gebäudeklasse, Abstandsflächennachweis, Stellplatznachweis. Alles muss genau sein. Eine ungenaue Zeichnung reicht nicht.
- Gutachten: Bei komplexen Fällen - besonders bei Abstandsfragen oder städtebaulichen Auswirkungen - lohnt sich ein Gutachten von einem Sachverständigen. Die Behörde vertraut oft mehr einem Expertenbericht als deiner Aussage.
Ein Beispiel aus Frankfurt: Ein Bauherr wollte ein Altgebäude sanieren, aber die vorgeschriebene Geschosshöhe ließ keine nutzbare Wohnung mehr zu. Mit einem statischen Gutachten und einer detaillierten Darstellung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit wurde die Befreiung für einen zusätzlichen Geschossaufbau genehmigt - ohne die Nachbarn zu beeinträchtigen.
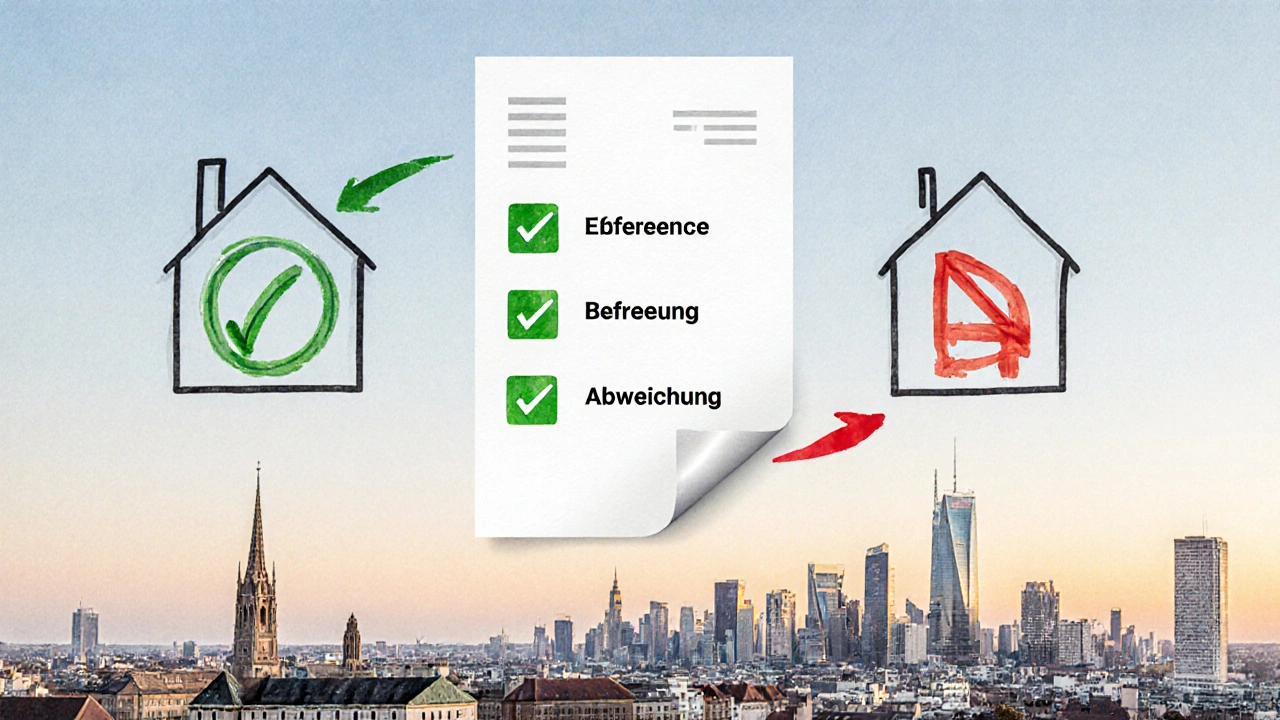
Wie lange dauert es und was kostet es?
Die Bearbeitungszeit liegt zwischen vier und zwölf Wochen. In kleinen Gemeinden geht es schneller, in Großstädten mit hohem Aufkommen oft länger. Wenn du alle Unterlagen vollständig einreichst, sparst du wertvolle Zeit. Viele Anträge scheitern nur, weil Dokumente fehlen - und dann muss alles von vorne geprüft werden.
Die Gebühren variieren je nach Kommune. In Linz oder Wien liegt der Bereich typischerweise zwischen 50 und 500 Euro. Die Höhe richtet sich nach dem Umfang des Antrags - eine einfache Abweichung kostet weniger als eine komplexe Befreiung mit Gutachten. Die Gebührenordnung findest du auf der Website deiner Stadt - meist unter „Bauverwaltung“ oder „Gebühren“.
Warum scheitern die meisten Anträge?
Die häufigsten Gründe für Ablehnungen sind nicht technisch, sondern strategisch.
- Die Grundzüge der Planung werden berührt: Das ist der größte Fehler. Wenn du in einem reinen Wohngebiet ein Gewerbegebäude bauen willst, ist das keine Befreiung - das ist ein Planänderungsverfahren. Und das dauert Jahre.
- Keine konkrete Begründung: „Ich brauche mehr Platz“ reicht nicht. Du musst zeigen: Warum kann ich es nicht anders machen? Welche wirtschaftlichen, baulichen oder sozialen Konsequenzen hat die strikte Einhaltung?
- Nachbarliche Einwände: Die Behörde muss die Nachbarn anhören. Wenn sie schriftlich Einwände erheben - etwa wegen Schattenwurf, Lärm oder Verlust von Licht - und du nicht darauf reagierst, ist die Ablehnung fast sicher. Sprich deine Nachbarn vorher an. Zeige ihnen deine Pläne. Biete Lösungen an. Das erhöht deine Chancen enorm.
Ein Fall aus der Praxis: Ein Antrag in einer Kleinstadt wurde abgelehnt, weil der Antragsteller die Abstandsflächen um 20 cm reduzieren wollte - aber keine Fotos der Nachbarhäuser beigefügt hatte. Die Behörde konnte nicht prüfen, ob die Schattenwirkung wirklich unbedeutend war. Ein zweiter Antrag mit Fotos, Schattenberechnungen und einem Brief des Nachbarn, der zustimmte, wurde innerhalb von drei Wochen genehmigt.

Was kannst du tun, wenn dein Antrag abgelehnt wird?
Ein Ablehnungsbescheid ist nicht das Ende. Du kannst Widerspruch einlegen - und zwar innerhalb eines Monats. Aber: Mach das nicht ohne rechtliche Beratung. Ein Anwalt für Bau- und Architektenrecht kann dir zeigen, ob die Ablehnung rechtlich haltbar ist. Oft liegt der Fehler nicht im Gesetz, sondern in der Begründung der Behörde.
Manchmal hilft auch ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter. Frag nach: „Was genau fehlt? Welche Unterlagen oder Argumente würden den Antrag überzeugen?“ Die meisten Behörden sind offen für konstruktive Gespräche - solange du nicht drohst oder dich beschwerst.
Was ändert sich aktuell?
Seit der Baurechtsnovelle vom Dezember 2021 gibt es eine klare Tendenz: Befreiungen für den Wohnungsbau werden einfacher. Die Bundesregierung will mehr Wohnungen - und Befreiungen sind ein schneller Weg als eine Neuaufstellung des Bebauungsplans. Viele Städte, auch in Oberösterreich, nutzen das jetzt gezielt. Aber: Es gibt auch Kritik. Fachleute warnen, dass zu viele Befreiungen die Planungssicherheit untergraben. Wer heute eine Befreiung bekommt, könnte morgen die Nachbarn behindern - wenn die Stadt später eine neue Regelung erlässt.
Die Digitalisierung hilft: In Nordrhein-Westfalen kannst du deine Unterlagen jetzt online einreichen. In Linz ist das noch nicht der Fall - aber es kommt. Mach dich darauf gefasst, dass in Zukunft alle Unterlagen digital bereitgestellt werden müssen - PDFs, klare Dateinamen, keine Scan-Abzüge.
Was ist der nächste Schritt?
Wenn du einen Antrag in Erwägung ziehst, mach das nicht allein. Gehe zuerst zur Bauverwaltung deiner Stadt - in Linz ist das das Magistrat, Abteilung Bauamt. Frag nach: „Gibt es in meinem Gebiet bereits ähnliche Befreiungen?“ Zeig deine Pläne. Lass dich beraten. Oft kannst du schon vor dem Antrag einen Termin mit dem Sachbearbeiter vereinbaren - das spart Zeit und vermeidet Fehler.
Und: Sammle Beweise. Fotos, Gutachten, Briefe von Nachbarn, wirtschaftliche Berechnungen. Je konkreter du bist, desto besser. Eine Befreiung ist kein Geschenk - sie ist ein juristischer Kompromiss. Und wie jeder Kompromiss: Er funktioniert nur, wenn beide Seiten etwas gewinnen.
Kann ich eine Befreiung vom Bebauungsplan ohne Anwalt beantragen?
Ja, du kannst einen Antrag ohne Anwalt stellen. Viele Bauherren tun das. Aber die Erfolgsquote steigt deutlich, wenn du professionelle Unterstützung hast - besonders bei komplexen Fällen. Ein Anwalt oder ein Architekt mit Baurechtserfahrung weiß, wie du die Begründung formulieren musst, damit die Behörde sie akzeptiert. Ohne Expertise scheitern viele Anträge an Formulierungen, die juristisch ungenau sind.
Wie oft werden Befreiungen genehmigt?
Es gibt keine bundesweite Statistik, aber in Städten wie Frankfurt, Berlin oder Linz werden etwa 30-50 % der Befreiungsanträge genehmigt. Die Quote hängt stark vom Grund ab: Bei Wohnungsbau und Flüchtlingsunterkünften liegt sie oft über 60 %. Bei reinen privaten Interessen - wie einem größeren Gartenhaus - sinkt sie auf unter 20 %. Die Qualität der Begründung ist entscheidend.
Gibt es Zeiten, in denen Befreiungen leichter zu bekommen sind?
Ja. Seit 2021 ist die gesetzliche Grundlage für Befreiungen im Wohnungsbau deutlich erleichtert worden. Städte mit Wohnungsnot - wie Linz, Wien oder Salzburg - nutzen das aktiv. Auch in Zeiten hoher Baupreise oder nach Naturkatastrophen werden Befreiungen oft flexibler gehandhabt. Wenn du einen dringenden Wohnbedarf hast, ist das der beste Zeitpunkt, um zu beantragen.
Was passiert, wenn ich ohne Befreiung baue?
Du riskierst eine Baustilllegung, eine Geldstrafe oder sogar die Rückbauverpflichtung. Die Behörde kann den Bau stoppen - und dich zwingen, alles wieder abzubauen. Das kostet mehr als jede Befreiung. Auch wenn du denkst, „keiner wird es merken“: Nachbarn melden oft an, und die Behörde prüft regelmäßig. Ein illegaler Bau bleibt ein Risiko für deine Eigentumsrechte - und kann später den Verkauf des Hauses unmöglich machen.
Kann ich eine Befreiung auch für einen Anbau beantragen?
Ja, das ist einer der häufigsten Anwendungsfälle. Ob du einen Dachaufbau, einen Erker oder einen Anbau an der Rückseite willst - wenn er gegen die Abstands- oder Höhenregeln verstößt, kannst du eine Befreiung beantragen. Wichtig ist: Du musst zeigen, dass der Anbau die städtebauliche Gesamtgestaltung nicht beeinträchtigt und dass du keine andere Lösung hast. Oft hilft hier ein guter Entwurf mit Licht- und Schattenberechnungen.
- Beliebte Tags
- Bebauungsplan
- Abweichung
- Befreiung
- Bauantrag
- Baurecht










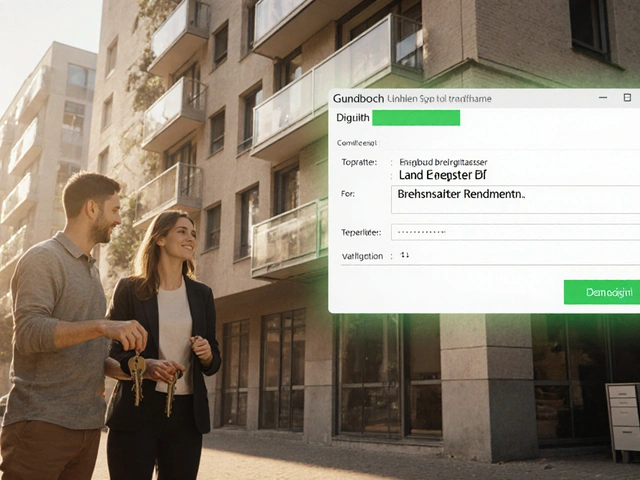

Personenkommentare
Das ist wieder so ein typischer Fall von juristischem Wirrwarr, den die Behörden sich ausgedacht haben, um Bauherren zu verunsichern. Befreiung, Abweichung, Ausnahme – das ist doch bloß eine künstliche Unterscheidung, um die Verwaltung zu beschäftigen. Wer braucht das? Einfach sagen: Ich will bauen, und dann gucken, ob’s geht.
Ich hab letztes Jahr auch so einen Antrag gemacht, weil ich meinen Keller ausbauen wollte, aber der Abstand zum Nachbarn nicht passte. Ich hab alles richtig gemacht, Fotos gemacht, Gutachten bestellt, sogar den Nachbarn eingeladen, um mit ihm zu reden. Und dann kam der Bescheid: Ablehnung, weil die Schattenberechnung nicht genau genug war. Ich war so wütend, hab drei Wochen gebraucht, um mich wieder aufzuraffen. Aber jetzt hab ich’s geschafft, mit einem neuen Gutachten und einem Brief vom Nachbarn, der sagt, er findet’s okay. Es geht eben nur mit Geduld und viel Papier.
Das ist so wichtig, was hier steht! Ich hab’s auch erlebt, dass Nachbarn plötzlich alles verhindern wollen, nur weil sie Angst vor Schatten haben. Aber wenn man sie vorher anspricht, ihnen zeigt, wie es aussehen wird, und sogar einen Kaffee mit ihnen trinkt, dann wird es ganz anders. Es geht nicht nur um Gesetze, sondern um Menschen. Danke für diesen klaren Text, der endlich mal sagt, wie es wirklich läuft.
Ich hab vor zwei Jahren nen Anbau gebaut ohne Antrag… und nix passiert. Kein Bescheid, kein Problem. Die Nachbarn haben’s nicht mal gemerkt. Vielleicht ist das ja auch ne Option? 😅
Die Unterscheidung zwischen Befreiung und Abweichung ist nicht künstlich, sondern ein zentrales Prinzip des deutschen Baurechts. §31 BauGB regelt die städtebauliche Planung, §66 Landesbauordnung die bautechnische Ausführung. Wer das verwechselt, versteht nicht, wie Recht funktioniert – und landet dann vor Gericht. Dieser Artikel ist zwar gut strukturiert, aber er verharmlost die juristische Komplexität. Es geht nicht um ‘Gutachten holen’ – es geht um die korrekte Anwendung von Normen in einem hierarchischen Rechtssystem.
Interessant, dass in Linz die Gebühren genannt werden – aber Linz ist in Österreich. Das ist ein Fehler. In Deutschland ist das alles anders. In Berlin zahlt man für einen Befreiungsantrag mit Gutachten bis zu 1.200 Euro. Und die Bearbeitungszeit? Sechs Monate, wenn du Glück hast. Diese Artikel, die ‘Linz’ als Beispiel nennen, ohne zu erwähnen, dass es nicht in Deutschland liegt, sind irreführend.
Ich komme aus der Schweiz und finde es toll, dass ihr hier so detailliert erklärt, wie das funktioniert. Bei uns ist es ähnlich, aber wir haben ein ‘Beratungsgespräch vor Antrag’ als Pflicht. Das spart so viel Zeit! Vielleicht sollte das auch in Deutschland eingeführt werden. Ein bisschen mehr Kommunikation, weniger Papierkrieg – das wäre doch eine gute Reform.
Ich hab das alles schon mal gemacht. Die Behörde hat gesagt: ‘Kein Problem, wenn Sie den Abstand einhalten’. Ich hab’s gemacht. Dann haben die Nachbarn gesagt: ‘Aber die Dachform ist falsch’. Also hab ich die Dachform geändert. Dann haben die gesagt: ‘Aber die Farbe passt nicht’. Ich hab die Farbe geändert. Dann haben sie gesagt: ‘Aber der Zaun ist zu hoch’. Ich hab den Zaun abgebaut. Jetzt wohne ich in nem Haus ohne Dach, ohne Zaun, und mit einer Wand, die 10 cm zurück ist. Und sie sagen immer noch: ‘Das ist nicht perfekt’.
Die strukturelle Differenzierung zwischen Befreiung nach §31 BauGB und Abweichung nach §66 Landesbauordnung ist essenziell, um die Rechtskonsistenz im Baurecht zu gewährleisten. Die städtebauliche Planungssicherheit als kollektives Interesse steht im Spannungsfeld mit individuellen Bauanliegen – eine Abwägung, die nur durch evidenzbasierte Dokumentation und transparenzorientierte Kommunikation legitimiert werden kann. Die hier dargestellten Fallbeispiele verdeutlichen, dass der Erfolg von Anträgen nicht vom Recht allein, sondern von der Qualität der Argumentationsstruktur abhängt.
Wusstet ihr, dass die Stadtverwaltungen diese Regeln absichtlich kompliziert machen, damit sie mehr Geld verdienen? Die Gebühren steigen, die Bearbeitungszeiten werden künstlich verlängert, und wenn du einen Antrag ablehnst, kommt der nächste Kunde. Das ist kein Zufall. Es gibt ein geheimes Memorandum von 2020, das besagt: ‘Je länger der Prozess, desto höher die Einnahmen’. Ich hab’s von einem ehemaligen Sachbearbeiter. Die Leute glauben, sie kämpfen gegen Vorschriften – aber sie kämpfen gegen ein System.
Wer ohne Anwalt einen Antrag stellt, ist ein Dummkopf. Das ist wie Selbstoperation mit einer Küchenmesser. Du denkst, du kannst das, aber dann hast du ne Infektion und brauchst ne OP. Und die kostet noch mehr. Lass das den Profi machen. Du willst doch nicht, dass dein Haus abgerissen wird, nur weil du ‘einfach mal’ was geändert hast?
Ich hab vor drei Jahren einen Befreiungsantrag für einen Dachaufbau gestellt – und er wurde abgelehnt, weil der Nachbar ‘Lichtverlust’ befürchtet hat. Ich hab ihm einen Sonnenstrahl-Visualizer geschickt, eine Excel-Tabelle mit Stunden, und dann einen Brief geschrieben, dass ich ihm ein neues Fenster bezahle, wenn er zustimmt. Er hat unterschrieben. Der Antrag wurde genehmigt. Es geht nicht ums Gesetz. Es geht ums Menschliche. Wenn du denkst, du musst nur die Behörde überzeugen, bist du auf dem Holzweg.
Ein kleiner Hinweis zur Orthografie: In der Überschrift ‘Abweichungen und Befreiungen vom Bebauungsplan beantragen’ ist ‘vom’ korrekt, aber im Fließtext steht ‘vom Bebauungsplan’ – hier wäre ‘von’ korrekt, da es sich um eine abstrakte Beziehung handelt. Kleinigkeit, aber für juristische Dokumente entscheidend. Auch ‘Gutachten von einem Sachverständigen’ sollte ‘Gutachten eines Sachverständigen’ heißen. Kleine Fehler, große Wirkung.
Recht ist kein Werkzeug, sondern ein Rahmen. Die Befreiung ist kein Recht, sondern ein Ausnahmefall – und das ist gut so. Planungssicherheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage einer funktionierenden Stadt. Wer sie untergräbt, zerstört das Vertrauen. Ein Antrag muss nicht nur rechtlich stichhaltig sein, sondern auch moralisch vertretbar. Das ist der Kern.
Es ist faszinierend, wie ein einfacher Wunsch – ein Dachaufbau, ein Anbau – in ein komplexes System aus Normen, Interessen und Machtverhältnissen verwandelt wird. Wir bauen Häuser, aber wir bauen auch Gesellschaft. Die Frage ist nicht nur: ‘Kann ich bauen?’ Sondern: ‘Was für eine Gesellschaft wollen wir?’ Wenn wir alles erlauben, verlieren wir das Gemeinsame. Wenn wir alles verbieten, verlieren wir das Menschliche. Die Befreiung ist kein Loch im System – sie ist die Nahtstelle, wo Gesetz und Leben aufeinandertreffen.
Die meisten dieser Anträge scheitern, weil die Antragsteller keine Ahnung von Recht haben. Sie schreiben ‘Ich brauche mehr Platz’ – als ob das ein juristischer Grund wäre. Recht ist kein Wunschzettel. Es ist ein System, das auf Präzision, Dokumentation und logischer Argumentation basiert. Wer das nicht versteht, sollte lieber aufhören, zu bauen. Und wer glaubt, dass ‘Nachbarn überzeugen’ die Lösung ist – der hat das Wesen der Verwaltung nie verstanden. Die Behörde prüft nicht die Gefühle. Sie prüft die Akten.